Parabeln untersuchen
Eine Parabel ist ein erzählender, gleichnishafter Text, der eine abstakte Vorstellung oder Aussage bildhaft darstellt. Sie ist einem Vergleich ähnlich, der jedoch zu einer selbstständigen Erzählung erweitert wurde. Die Parabel ist eine Form lerhafter Prosa.
Parabeln enthalten eine Bild- und eine Sachebene. Meist gibt es keine expliziten Hinweise zur Verbindung von Bild- und Sachebene. Die Lesenden stellen die Verknüpfung der Ebenen selbst her.
Bildebene =
Darstellungsebene
das tatsächlich Erzählte
die konkrete Handlung, das Geschehen
Sachebene =
Deutungsebene
der übertragene Sinn
die abstrakte Vorstellung oder Aussage
eine mögliche Lehre
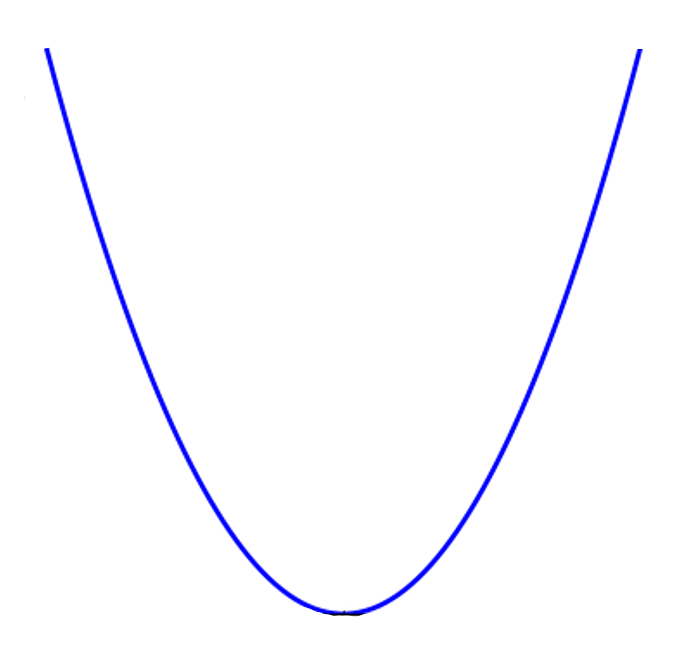
tertium comparationis =
Schnittstelle von Bild- und Sachebene
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/was-steckt-hinter-dem-gesetz-kafkas-parabel-vor-dem-gesetz-analysieren-und-deuten
Materialsammlung
[1] Eine andere, ebenfalls im Zusammenhang mit Vor dem Gesetz schon besprochene Möglichkeit, auf Beziehungsfallen zu antworten, besteht darin, schwer entschlüsselbaren Botschaften der Umgebung dadurch zu entgehen, daß man sich auf sich selbst zurückzieht. Dieser Mechanismus zeigt sich deutlich im Verhalten des Mannes vom Lande, der sich gegen Ende seines Lebens vorwiegend mit sich selbst und den Flöhen des Türhüters unterhält, die ihm in keiner Weise gefährlich werden können. Dadurch verringern sich sowohl die Angriffsflächen als auch die Anzahl möglicher Konflikte und Fehldeutungen. Für einen flüchtigen Beobachter mag der Anschein entstehen, er habe einen zurückgezogenen, schweigsamen Menschen vor sich.
[2] Noch verhängnisvoller ist jedoch der Entschluss des Mannes, wegen der gefürchteten Schwierigkeiten von nun an untätig auf die Erlaubnis zu warten. Dadurch verliert er sein ursprüngliches Ziel aus den Augen, verschwendet seine Zeit, ja sein Leben auf der untersten Stufe seines Daseins, erschöpft sich in oberflächlichen und sinnlosen Geschäftigkeiten, die alle auf derselben flachen Ebene verharren, weil er inzwischen den unterste Türhüter für das einzige Hindernis hält.
[3] Das Gesetz soll, so glaubt der Mann vom Lande am Beginn der Parabel, jedem und immer zugänglich sein. Wie ihn der Türhüter belehrt, ist es zwar möglich, in das Gesetz einzugehen, „jetzt aber nicht“, was herkömmlich bedeutet: Später wird es möglich sein. Später erfährt der Mann von Lande allerdings, dass es nie möglich wird. Ganz auf dieser Linie liegt, dass das Tor zum Gesetz offen steht „wie immer“, aber zugleich durch den Türhüter verschlossen ist. Das ist widersprüchlich, ja paradox. Eine Sache kann doch nicht dies und zugleich das genaue Gegenteil davon sein. […] [Den] seltsam verschwimmenden Gegensatz zwischen Staatlich-Allgemeinem und Privat-Individuellem führt uns miniaturartig auch die Türhüterparabel vor. Hier ist das Gesetz, dort der Mann vom Lande, und zwischen ihnen eine Tür, die der Mann nie durchschreiben kann, obwohl sie immer offen steht. Sie wird durchlässig gemacht und zugleich befestigt durch den Türhüter, der dem Mann vom Lande auch noch einen Schemel reicht, den dieser ab nun neben dem Gesetz bewohnt. […] Wider jede Erwartung hat sich das Staatlich-Allgemeine individualisiert und dem Mann von Lande einen nur bestimmten Eingang zugewiesen, und dennoch durchschreitet der Mann die Tür sein ganzes Leben lang nicht. Das ist nicht nur paradox, sondern auch bitter. Denn der Mann vom Lande hat doch alles versucht, und der Türhüter hat anscheinend nur seine Pflicht getan. Genau diese Vergeblichkeit entspricht allerdings den Enttäuschungen, die viele Menschen erleben, wenn sie das Recht suchen.
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/was-steckt-hinter-dem-gesetz-kafkas-parabel-vor-dem-gesetz-analysieren-und-deuten
[4] Der entscheidende Knotenpunkt des Textes ist die Verknüpfung der Frage des schon sterbenden Mannes vom Lande: „Alle streben doch nach dem Gesetz, wieso kommt es, daß in den vielen Jahren niemand außer mir Einlaß verlangt hat?“ mit der Auskunft des Türhüters: „Hier konnte niemand sonst Einlaß erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.“ Die Auskunft des Türhüters setzt alle Voraussetzungen außer Kraft, unter denen die Legende bis dahin stand: Von anderen Eingängen war nicht die Rede und daß niemand sonst zu diesem Eingang kam [sic] müßte ja bedeuten, daß die anderen die Zuordnung dieses Einganges zu dieser Person (die obendrein als Individuum gar nicht in Erscheinung trat), schon von weitem hätten erkennen müssen, was die Frage aufwerfen würde, warum der Mann vom Lande diese Zuordnung nicht erkannt hat. Oder der Türhüter spielt seine Rolle weiter, auch als er „erkennt, daß der Mann schon an seinem Ende ist“. Wen die Auskunft des Türhüters gegenüber dem Sterbenden die blanke Wahrheit wäre, wenn jeder sein eigenes, geöffnetes Tor zum Gesetz hätte, dann hätte der Türhüter keine wirkliche Funktion mehr als nur die rein negative, dem Einzelnen den Zugang drohen zu versperren. Dann wäre die Gesamtproblematik eine rein individuelle und der Sinn von Gesetz und Läuterung verloren. Der Zutritt zum Gesetz wäre zu einer Art Mutprobe verkommen.
Auszüge aus:
[1] Binder, Hartmut (1993): Vor dem Gesetz
. Einführung in Kafkas Welt. Stuttgart, Weimar: Metzler, S. 237.
[2] Eschweiler, Christian (2005): Franz Kafka und sein Roman-Fragment Der Prozess. Neu geordnet ergänzt erläutert. Weilerswist: Landpresse, S. 174.
[3] Pöschl, Magdalena (2019): „‚Dieser Eingang war nur für dich bestimmt‘“, in: Bezemek, Christoph (Hrsg.): Vor dem Gesetz. Rechtswissenschaftliche Perspektiven zu Franz Kafkas „Türhüterlegende“. Wien: MANZ, S. 37–39.
[4] Voigts, Manfred (1994): „Von Türhütern und von Männern vom Lande, Traditionen und Quellen zu Kafkas Vor dem Gesetz“, in: Ders. (Hrsg.): Franz Kafka ‚Vor dem Gesetz‘. Aufsätze und Materialien. Würzburg: Königshausen und Neumann, S. 116f.
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/was-steckt-hinter-dem-gesetz-kafkas-parabel-vor-dem-gesetz-analysieren-und-deuten


